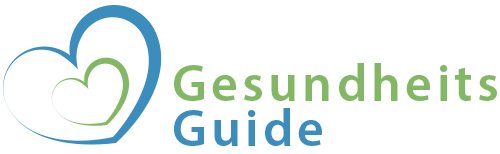Phytotherapie
Bei der Phytotherapie handelt es sich um die Pflanzenheilkunde. Hierbei werden aus ganzen Pflanzen oder nur Pflanzenteilen Tees, Extrakte, Pulver oder Tinkturen hergestellt, mit denen man verschiedene Beschwerden oder Erkrankungen heilen oder ihnen vorbeugen kann.
Phytopharmaka besitzt kaum Nebenwirkungen
Die Zubereitungen aus den Pflanzen bieten eine große Bandbreite von Behandlungsmöglichkeiten und Wirkweisen und haben den großen Vorteil, dass sie kaum Nebenwirkungen hervorrufen, wie das die synthetisch hergestellten Medikamente meist tun. Es gibt inzwischen über 20.000 Pflanzen aus aller Welt, welche in der Naturheilkunde einen festen Platz haben und als Medikament verwendet werden.
Die Rohstoffe der Phytotherapie
Zum Einsatz kommen bei der Phytotherapie oberirdische Teile wie Blatt, Frucht, Blüte, Stängel, Hülse, Knospe, Rinde, Holz, Zweige und Zweigspitzen sowie unterirdische Teile wie Samen, Wurzeln und Wurzelstöcke. Dabei kommt es sehr darauf an, dass qualitativ hochwertige Pflanzen verwendet werden, um die Wirkung zu garantieren.

Geschichtliches zur Phytotherapie
In allen Kulturen dieser Welt findet sich die Phytotherapie als Basis des jeweiligen Medizinsystems. Bei der Naturheilkunde steht die Ganzheit des Menschen und seiner Gesundheit im Vordergrund, die auf die drei Säulen Körper, Psyche und Seele gebaut ist. Schon vor 6000 Jahren wurden am Persischen Golf Aufzeichnungen über Pflanzen und ihre Wirkweise oder Zubereitung niedergeschrieben, wie Funde bestätigten. Aus Ägypten stammt ein Papyrus mit über 600 Pflanzenarten und ihren Anwendungen für Heilzwecke, aus China stammt ein Kräuterbuch mit ca. 1000 Heilpflanzen, das ca. 5000 Jahre alt ist. Auch die griechischen Ärzte Hippokrates und Dioskorides waren in der Kräuterheilkunde sehr versiert.
Als Gründer der Pharmakologie, der sich mit der positiven und negativen Wirkweiser verschiedener Stoffe befasste, gilt der Arzt Claudius Galenus.
Bekannt für ihr Wissen und die Anwendung von Pflanzen als Heilmittel sind noch immer Hildegard von Bingen und Paracelsus. Paracelsus wurde lange Zeit nicht für ernst genommen, da er aufgrund des Aussehens einer Pflanze auf ihre heilende Wirkweise schloss, wie beim Lungenkraut, dessen fleckig aussehende Blätter seiner Meinung nach an Lungengewebe erinnern. Inzwischen wurden seine Thesen durch moderne Forschungen bestätigt und Lungenkraut findet seinen Einsatz bei der Behandlung chronischer Atemwegserkrankungen.

Phytotherapie damals und heute
Wer sich damals als Kundiger der Kräuterheilkunde offenbarte, wurde nicht selten als Hexe oder Hexer verfolgt. Dabei und auch während der Zeit der Entwicklung chemischer Medikamente, wurde viel Wissenswertes über die Pflanzen und ihre Wirkweisen verloren oder vernichtet, was heute wieder neu entdeckt und beachtet wird. Dank den Pfarrern Kneipp, Weidinger und Künzle wurde die traditionelle Kräuterheilkinde weitergeführt und der Arzt Dr. Rudolf Fritz Weiss war Gründer des ersten Lehrstuhls für Phytotherapie, was ihm auch unter den Schulmedizinern Anerkennung brachte. Die Phytotherapie befasst sich mit der Wirkweise der Pflanzenstoffe auf die Patienten, während bei der Pharmakognosie nach Zerlegung der einzelnen Wirkstoffe die jeweils richtige Dosis ermittelt wird, welche ohne negative Folgen verabreicht werden kann. Pflanzenwirkstoffe sind auch in einigen Medikamenten aus der Schulmedizin enthalten.
Phytotherapie: Behandlung und Anwendung
Die Phytotherapie ist ein guter Weg, sich selbst zu behandeln, dabei ist die Zubereitung von Tees wohl die häufigste Form der Anwendung. Beim Trinken von Kräutertees ist es am besten, diese auf nüchternen Magen am Morgen zu trinken, da die Magenschleimhäute die Wirkstoffe so besser aufnehmen können. Dafür werden 1 bis 2 Teelöffel des Kräutertees empfohlen, bei Kindern nur die Hälfte. Wenn sie zu bitter sind, kann mit Honig gesüßt werden, der zudem antibakterielle Wirkung hat. Einzelne Kräuter sind gegenüber Kräutermischungen spezieller einzusetzen, da sich die Zubereitungsart der verschiedenen Kräuter ab und zu unterscheidet.
Kalte und heiße Auszüge der Pflanzen
Manche Pflanzenteile müssen mit heißem Wasser übergossen werden, sodass ihre ätherischen Öle austreten und werden fünf Minuten ziehen gelassen, andere sollten nur mit lauwarmem Wasser übergossen werden, müssen aber bis zu einer Stunde ziehen.
Kräuter und Wurzeln werden oft mit kaltem Wasser übergossen und erst anschließend aufgekocht, einige davon müssen bis zu 15 Minuten kochen und werden dann abgeseiht. Da einige Wirkstoffe in Pflanzenteilen hitzeempfindlich sind, werden diese mindestens 30 Minuten in kaltem Wasser gelöst. Keime, die sich auf manchen Kräutern befinden, können so nicht abgetötet werden, da zum Beispiel lebende Hefen von Beeren den Darmaufbau günstig beeinflussen können.

Gurgeln, Inhalieren, Baden, Waschungen oder Umschläge
Zum ein- bis fünfminütigen Gurgeln des Mund- und Rachenraumes verendet man am besten ungesüßten Tee. Für die Inhalation übergießt man 4 bis 6 Esslöffel Kräuter mit kochendem Wasser und inhaliert die aufsteigenden Dämpfe, indem man den Kopf unter einem Handtuch darüber hebt. Für Vollbäder wird zunächst eine größere Menge Tee zubereitet und dem Badewasser zugegeben. Um verletzte Arme oder Beine in ein Teilbad zu legen, kann der zubereitet Tee auch pur verwendet werden. Die Temperatur des Wassers sollte sowohl bei Voll- als auch bei Teilbädern zwischen 35 und 40 Grad betragen. Für Waschungen oder Umschläge tränkt man Mullstücke oder Baumwolltücher mit warmem Kräutertee, um sie anzuwenden.
Was gibt es noch für Anwendungsformen?
Zusätzlich zu den getrockneten Pflanzenteilen, mit denen man Tee etc. zubereiten kann, sind in der Apotheke zusätzliche Anwendungsformen erhältlich. Dazu gehören Dragees, Pulver, Tropfen, Salben, Kräutersäfte, Medizinalwein, Tinkturen (alkoholisch) oder auch Ölauszüge.
Wie wirkt die Phytotherapie?
Eingesetzt wird die Phytotherapie bei Beschwerden wie Atemwegserkrankungen und Erkältungen, Ein- und Durchschlafstörungen und Erschöpfungszustände, Magen und Darm-Beschwerden, Blasenleiden, Menstruationsprobleme, Hauterkrankungen, Verstauchung und Verletzungen.
Die meisten Ärzte beziehen die Phytotherapie in eine komplementärmedizinische Behandlung mit ein, da die Wirkweise der Zusammensetzung pflanzlicher Wirkstoffe wissenschaftlich erwiesen wurde. Um die heilende Wirkung der ätherischen Öle, Gerb- und Bitterstoffe, sowie Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente zu bewahren, kommt es auf die richtige Ernteweise, Trocknungszeit, Verarbeitung und Aufbewahrung an. Je nachdem, wo die Pflanzen gewachsen sind, kann sich die Zusammensetzung ihrer Inhaltsstoffe unterscheiden. Auch die Qualität der Kräuter ist stark unterschiedlich. Nur Heilkräuter, die in der Apotheke gekauft werden, entsprechen den Mindestanforderungen des Arzneimittelbuches. Wer sich selbst Kräutermischungen zusammenstellen möchte, sollte unbedingt darauf achten, dass sie aus Bio-Anbau stammen und nicht mit zu viel Umweltgiften belastet sind.